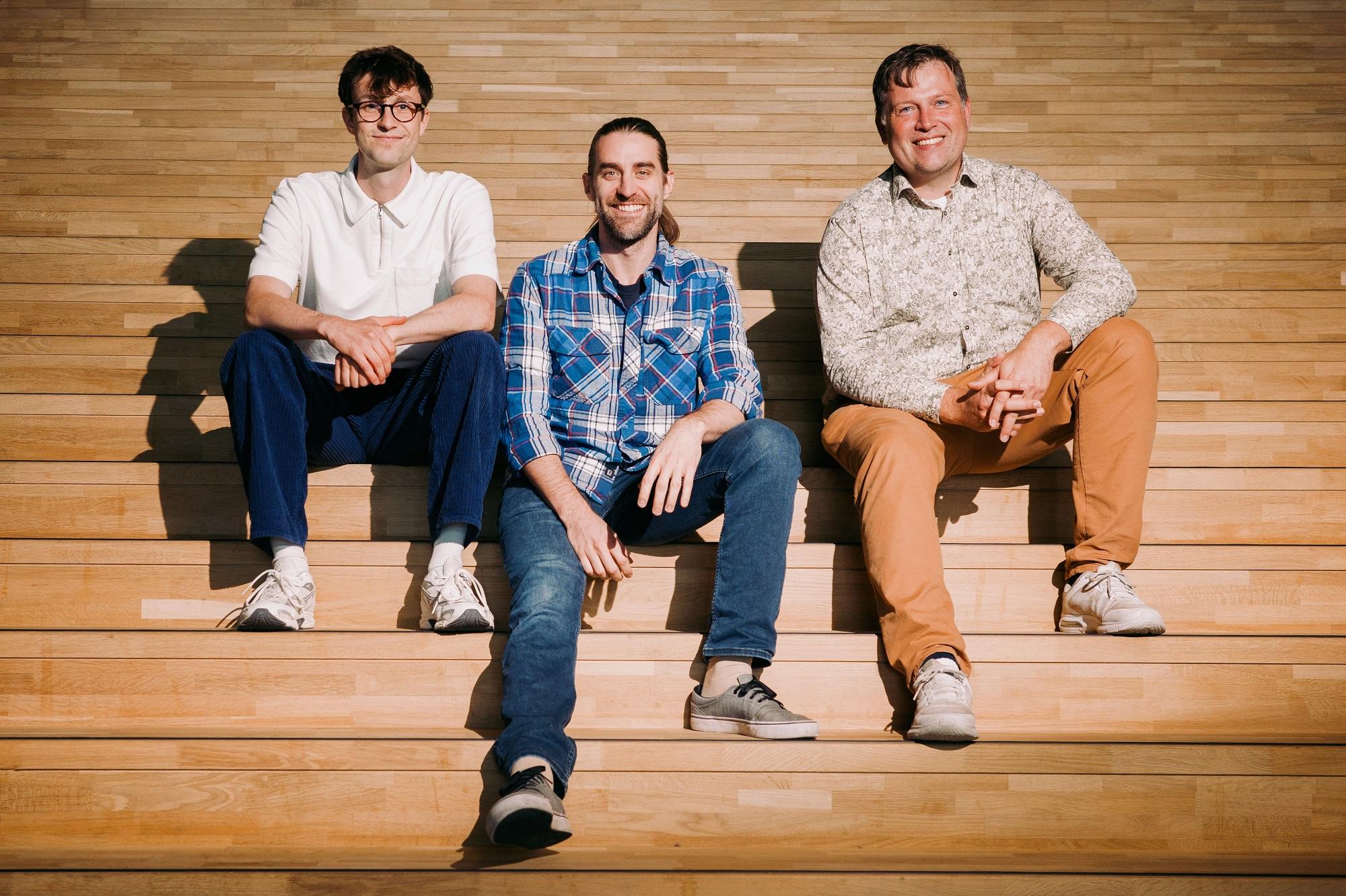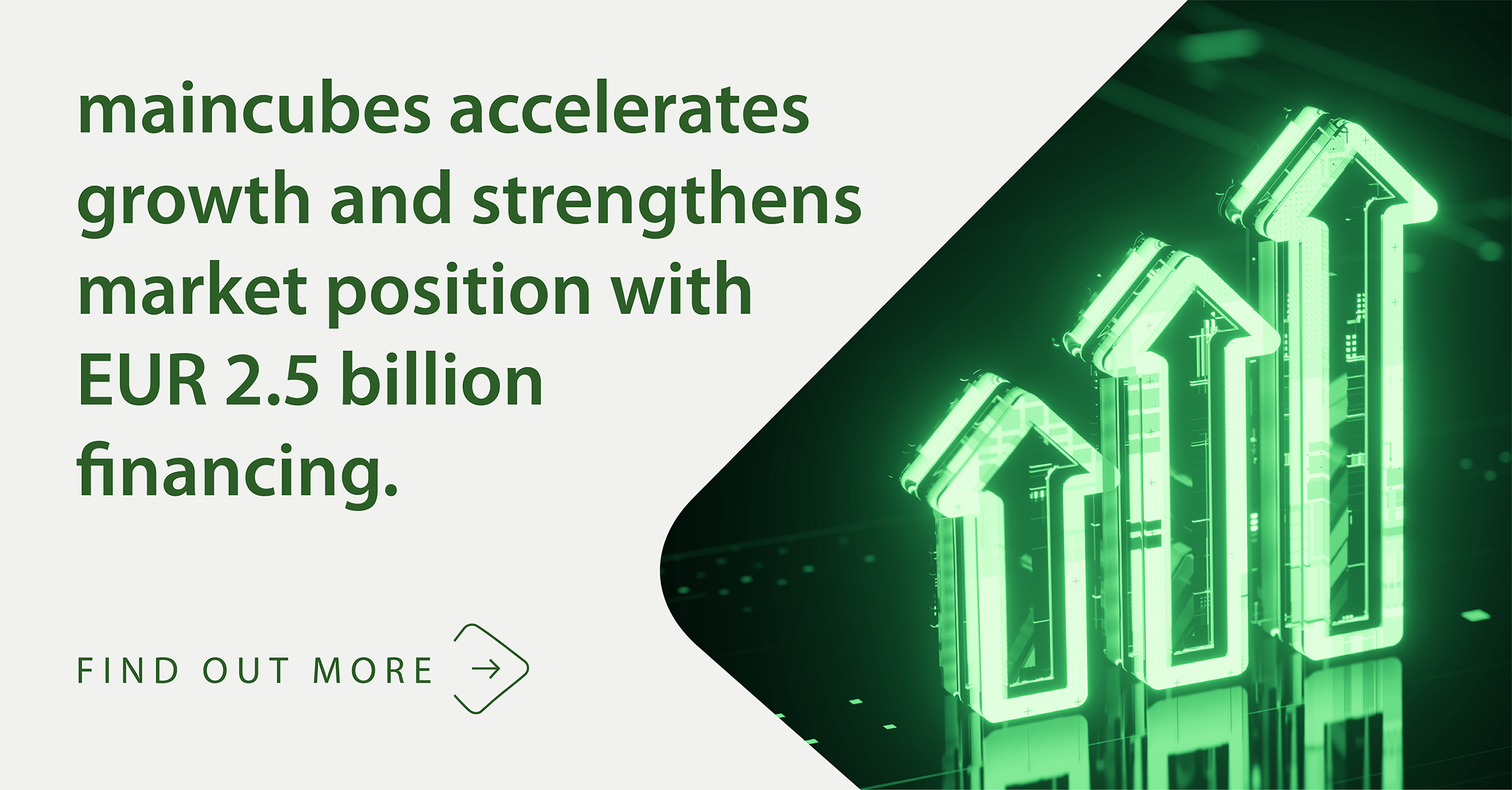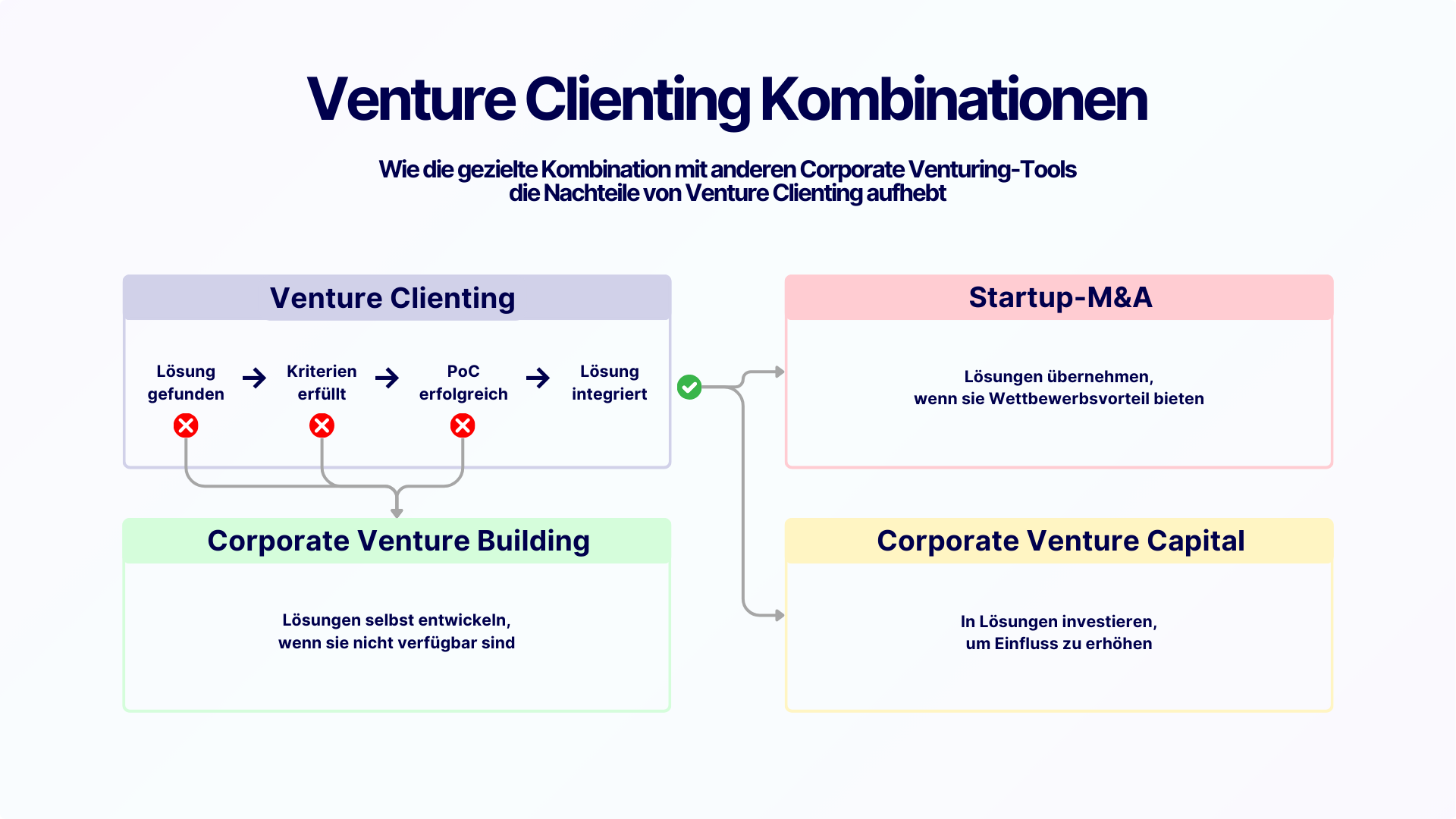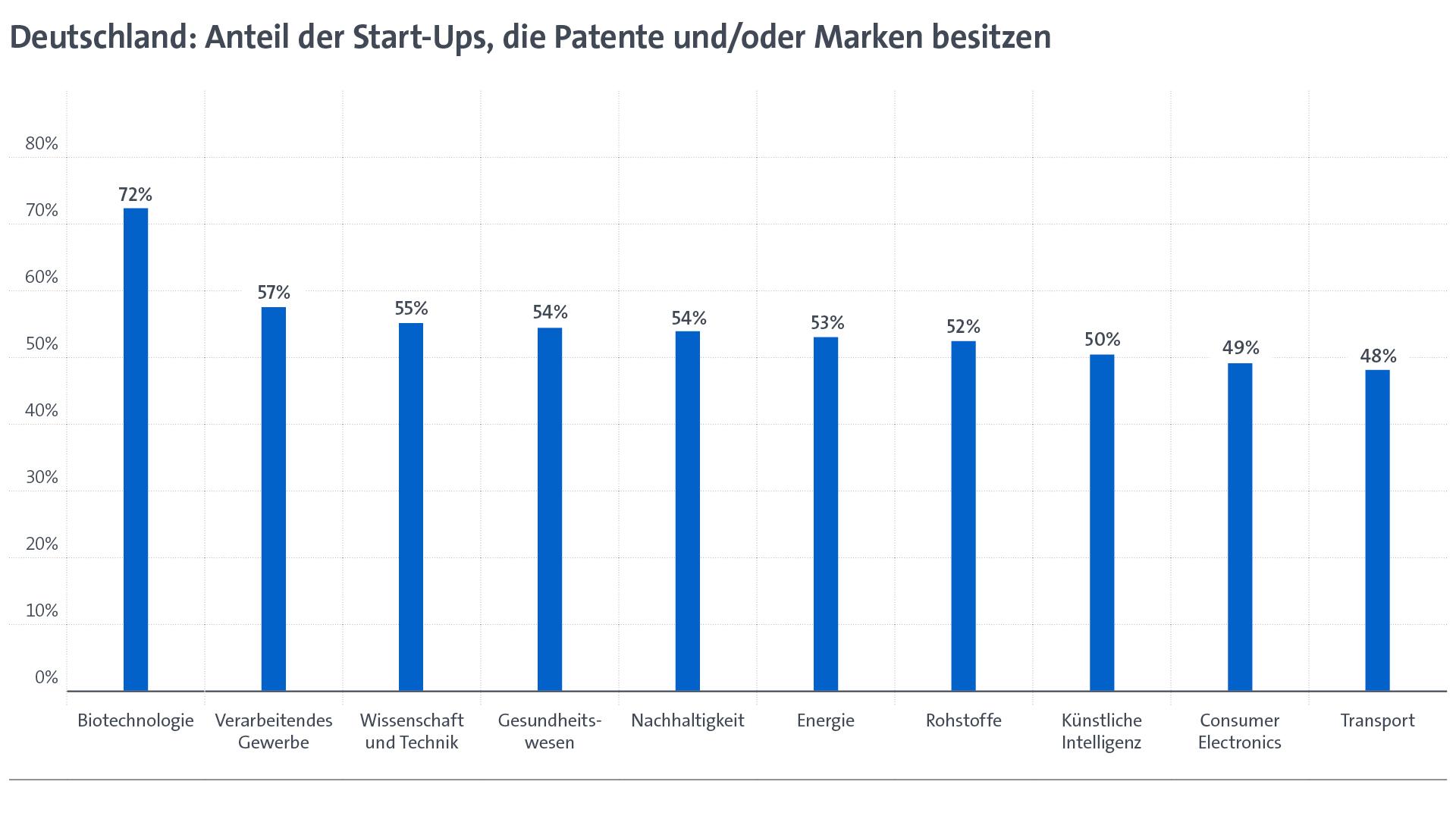Und jetzt alle!

Crowdfunding bietet Start-ups eine weitere Finanzierungsmöglichkeit. Allerdings gibt es große Unterschiede in der Ausgestaltung, nicht jede Form eignet sich für jedes Unternehmen.
Spätestens seit 2009 das Internetportal Kickstarter Crowdfunding zum Massenphänomen machte, haben auch Start-ups eine weitere Finanzierungsmöglichkeit. In Deutschland etwa Panono, eine Firma, die einen Kameraball entwickelte; oder Bonaverde, ein Start-up mit dem Plan, eine neuartige Kaffeemaschine zu entwickeln. Für Panono gab es 920.000 Euro, für Bonaverde 500.000 Euro. Jüngst erst gab die Neobank Tomorrow eine Fundingrunde für die Crowd frei und sammelte rund drei Millionen Euro ein. „Diese 2.000 Investoren sind für uns wie Botschafter“, frohlockte Mitgründer Michael Schweikart im Startbase-Interview. Von ihnen könne Tomorrow nützliches Feedback erwarten, um das eigene Produkt weiter zu verbessern.
Doch zeigen einige dieser Beispiele, wie heikel das Modell ist: Sowohl Panono als auch Bonaverde sind mittlerweile insolvent gegangen. Ein Schicksal, das rund ein Drittel aller Start-ups mit Crowdfinanzierung teilen, wie der Finanzexperte Markus Petry von der Wiesbaden Business School vergangenen Monat im Blog von Springer Professional warnte. Welche Vor- und Nachteile es beim Crowdfunding gibt und wie ein solcher Prozess am besten abläuft, das sollten sich Gründer deshalb sehr genau ansehen. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte.
Welche Formen von Crowdfunding gibt es?
Tatsächlich ist Crowdfunding nicht gleich Crowdfunding, es gibt gleich vier verschiedene Varianten. Diese unterscheiden sich vor allem darin, was der Investor für sein Geld erwarten kann.
Spenden-Crowdfunding: Hierbei bekommen die Geldgeber gar nichts zurück, sie geben ihr Geld bedingungslos an die Crowdfunding-Kampagne. Diese Variante ist für Start-ups mit Gewinninteresse allerdings eher unattraktiv, eher greifen hierauf gemeinnützige Organisationen zu, etwa die Initiative „Mein Grundeinkommen“, die mithilfe von Spenden Crowdfunding-Experimente mit dem bedingungslosen Grundeinkommen finanzieren will.
Belohnendes Crowdfunding: Bei dieser Variante erhält der Investor eine festgelegte Gegenleistung für sein Vertrauen. Sehr häufig geht es dabei um Produkte, die mit der Kampagne finanziert werden. Oft nutzen Künstler diese Vorgehensweise, indem sie per Crowdfunding finanzierte Alben und Filme den Geldgebern exklusiv oder zumindest vorrangig zugänglich machen. Auch Start-ups, die Produkte für Endverbraucher schaffen wollen, können dies nutzen. Vor einigen Jahren finanzierte sich so etwa die E-Skateboard-Firma Mellow Boards.
Verleihendes Crowdfunding: Beim sogenannten Crowdlending müssen die Unternehmer das eingebrachte Geld irgendwann zurückzahlen. Es gibt verschiedene Modelle, oft müssen die Start-ups aber Zinsen auf das eingesetzte Kapital zahlen, eventuell unabhängig vom Erfolg. Meist sind diese Zinsen recht hoch, schließlich sind Kredite an aufstrebende Unternehmen eher riskant. Panono etwa sammelte 2014 – nach der ersten Fundingrunde – noch einmal Geld ein, dieses Mal über Crowdlending.
Crowdinvesting: Hierbei werden die Investoren für ihr Geld am Unternehmenserfolg direkt beteiligt. Das Investment kann als Nachrangdarlehen behandelt werden, womit es faktisch Teil des Eigenkapitals der Firma wäre. Alternativ können die Geldgeber aber auch direkt Unternehmensanteile bekommen und so zum Beispiel bei einem möglichen Exit profitieren. Diese Variante nutzte auch Tomorrow, dessen Crowd-Investoren sind nun mit sechs Prozent an dem Fintech beteiligt.
Wann kann Crowdfunding funktionieren?
Crowdfunding lohnt sich vor allem für Gründer, die anderweitig Schwierigkeiten haben an Geld zu kommen. Wenn Bank und andere Kapitalgeber zurückschrecken, können sie ihre Ideen so direkt an potenzielle Kunden herantragen oder an Menschen, die ihre Vision teilen. Nur weil ein Start-up nicht direkt an Kapital kommt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Idee nichts taugt. Risikokapitalgeber etwa haben oft klare Portfolios und Bewertungsschemata, die meisten sagen ganz offen, dass sie nicht in jede Idee investieren, die funktionieren könnte. Banken sind sowieso vorsichtiger, fordern für Kredite oft Sicherheiten, die junge Gründer nicht liefern können.
Ein Vorteil von Crowdfunding ist der direkte Kontakt zu möglichen Kunden, wenn das Start-up ein Endverbraucherprodukt herstellt. So können die Produktentwickler erfahren, wie gut ihre Idee ankommt und ob es Verbesserungsbedarf gibt.
Was viele Gründer reizt: Je nach Crowdfundingform bleiben sie unabhängig. Die Investoren, die über die Plattformen kommen, erhalten im Gegensatz zu Risikokapitalgebern nicht unbedingt Anteile an der Firma und fordern auch keine vergleichbaren Rechenschaftspflichten ein wie etwa eine Bank.
Woran kann Crowdfunding scheitern?
Die gleichen Punkte, die für einen Schritt in diese Finanzierungsform sprechen, sprechen auch dagegen. Es hat oft Gründe, dass weder Bank noch VCs einem Start-up Geld geben wollen, vielleicht taugt die Idee einfach nichts, wenn mehrere Experten abwinken. Crowdinvestoren können außerdem nicht dieselbe Expertise in die Firma einbringen wie größere Geldgeber, die bereits zuvor viele Start-ups zur Marktreife gebracht haben. „Die Investoren können die Validität des Geschäftsmodells und die Erfolgsaussichten des finanzierten Start-ups selbst kaum einschätzen und sind auf die Risikoeinschätzung der Plattformbetreiber angewiesen“, warnt auch Finanzexperte Markus Petry in seinem Blogbeitrag.
Aber selbst, wenn die Gründer fest an ihre Idee glauben, gibt es weitere Schwierigkeiten. Wer die Massen begeistern will, der wird dies schwerlich mit harten Unternehmenszahlen tun, stattdessen braucht es auf Crowdfundingplattformen Enthusiasmus und Begeisterung, um Ziele zu erreichen.
Apropos Ziele: Oft setzen Crowdfundingplattformen fest, dass Interessenten eine klare Zahl angeben, die sie einsammeln wollen. Bei den meisten Anbietern fällt das gesamte Geld weg, wenn diese Zielmarke nicht erreicht wird. Sprich: Wer von angepeilten 500.000 Euro nur 490.000 einsammeln kann, der steht stattdessen mit leeren Händen da. Wer sich also am Crowdfunding versucht, sollte sich sehr gut überlegen, wie viel Geld er braucht.
Welche Plattformen gibt es?
Die weltweit größten Anbieter sind die amerikanischen Plattformen Kickstarter und Indiegogo, die seit einigen Jahren auch in Deutschland nutzbar sind. Kickstarter ist immer noch der Goldstandard der Branche, aber aufgrund der schieren Größe vielleicht nicht für jeden Nutzer interessant. Indiegogo hat den Vorteil, dass die Seite nicht auf ein zu erreichendes Fundingziel pocht.
Der deutsche Primus ist Startnext, der – ähnlich wie Kickstarter und Indiegogo – für jegliche Art von Crowdfunding offensteht, sowohl für Künstler als auch für Unternehmer. Hierzulande gibt es auch eine Reihe von Crowdinvesting-Plattformen, etwa Seedmatch, Companisto und Innovestment.
Mit Venturate ist auch ein Anbieter auf dem Markt, der „kuratiertes Crowdfunding“ anbietet. Dort gibt es pro Projekt einen Deal-Captain – meist ein Business Angel – der das Start-up prüft und die Bewertung aushandelt, die die Basis für alle weiteren Investments gilt.

Newsletter
Startups, Geschichten und Statistiken aus dem deutschen Startup-Ökosystem direkt in deinen Posteingang. Abonnieren mit 2 Klicks. Noice.
LinkedIn ConnectFYI: English edition available
Hello my friend, have you been stranded on the German edition of Startbase? At least your browser tells us, that you do not speak German - so maybe you would like to switch to the English edition instead?
FYI: Deutsche Edition verfügbar
Hallo mein Freund, du befindest dich auf der Englischen Edition der Startbase und laut deinem Browser sprichst du eigentlich auch Deutsch. Magst du die Sprache wechseln?