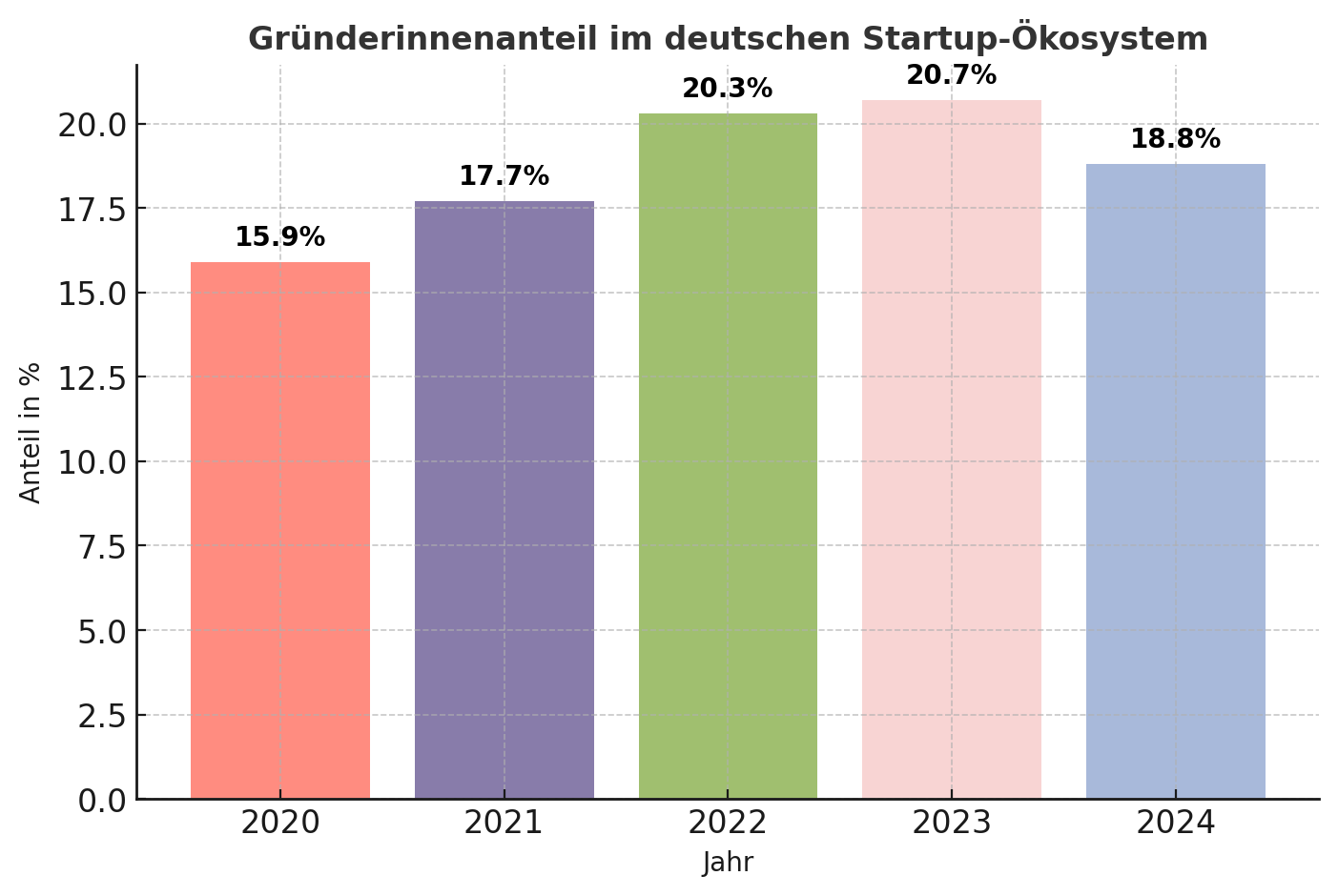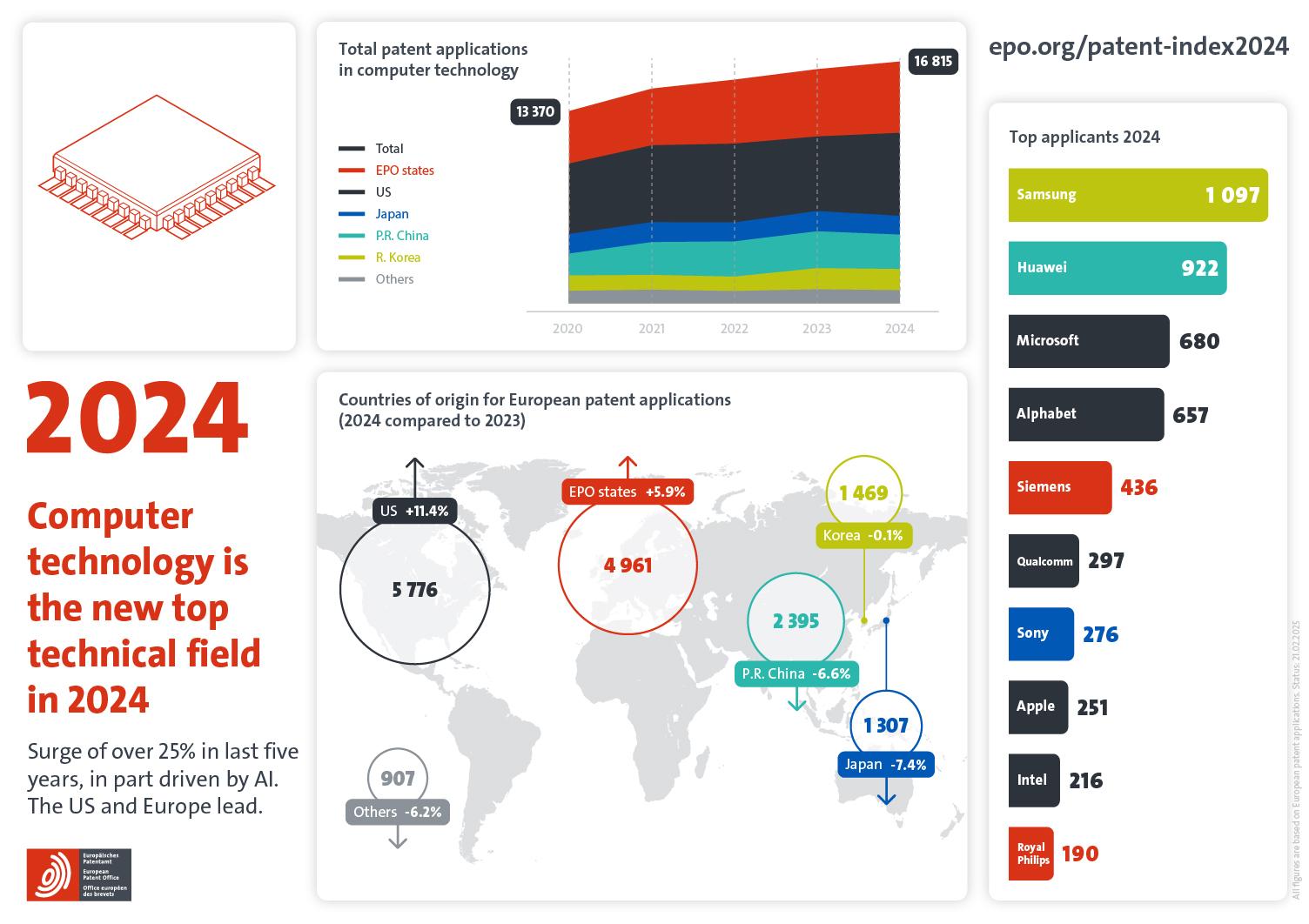Ist der Entwurf zum Fondsstandortgesetz ein „Rohrkrepierer“?

Durch das Fondsstandortgesetz soll das Arbeiten für Start-ups in Deutschland deutlich attraktiver werden. Doch die deutsche Start-up-Szene hält den bisherigen Entwurf für ungeeignet. Eine Übersicht der strittigen Punkte.
Bereits seit Wochen schwelt der Konflikt über den Entwurf der Bundesregierung zum Fondsstandortgesetz. Mit dem Gesetz will die Regierung unter anderem Jobs bei Start-ups attraktiver machen, in dem sie die Mitarbeiterbeteiligungen stärker fördert. Damit sollen Start-ups als Arbeitgeber im internationalen Vergleich interessanter für Fachkräfte werden. Denn solche Beteiligungen erhalten Mitarbeiter in Ländern wie den USA zum Beispiel häufig, um ihren geringen Lohn auszugleichen, in Deutschland sind sie bisher, auch wegen komplexer Steuerregelungen, eine Seltenheit.
Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutscher Start-ups nannte den am 20. Januar veröffentlichten Entwurf auf Twitter bereits einen „Rohrkrepierer“. Dadurch würden alle nur viel Zeit verlieren und den Start-ups nicht geholfen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach gegenüber dem Handelsblatt von einem „Manifest der Mutlosigkeit“. Auf eine kleine Anfrage der FDP zu einem der strittigen Punkte hin zeigte sich das federführende Finanzministerium unter Olaf Scholz zunächst allerdings nicht einsichtig und machte so wenig Hoffnungen auf große Änderungen.
Sechs Verbesserungsvorschläge hatte der Start-up-Verband schon im Dezember gemacht. Sie alle hat das Finanzministerium nach Darstellung von Christian Miele ignoriert. Doch der Verband gibt nicht auf, hat sich inzwischen auf drei Punkte beschränkt und am Mittwochabend gemeinsam mit dem Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung (AGP) und dem Dachverband der Führungskräfte (ULA) eine virtuelle Podiumsdiskussion zum Fondsstandortgesetz organisiert. Daran nahmen auch die Finanzpolitiker Fritz Güntzler für die CDU, Wiebke Esdar für die SPD und Katja Hessel für die FDP teil, die alle im Finanzausschuss des Bundestages sitzen. Von einem Rohrkrepierer wollten weder die Ausschussvorsitzende Katja Hessel noch Fritz Güntzler sprechen. Sie nannten den Entwurf einen „Placebo“. Der angekündigte große Wurf sei es sicherlich nicht, sagte Hessel, und selbst SPD-Politikern Wiebke Esdar, die erst später zur Runde stieß, sieht noch Verbesserungsbedarf am aktuellen Gesetzesentwurf, den ihr Parteifreund Olaf Scholz federführend betreut.
Höhe des Freibetrages zu niedrig
Der Entwurf des Fondsstandortgesetz sieht unter anderem vor, den Steuerfreibetrag für den Erwerb vergünstigter Mitarbeiterbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro zu erhöhen. Viel zu wenig, finden Start-up-Vertreter. Zwar wurde inzwischen bekannt, dass die Grenze auf 1.440 Euro angehoben werden soll, doch ist das im internationalen Vergleich noch immer wenig. In Österreich etwa gibt es eine Förderung von bis zu 4.500 Euro pro Jahr, in Großbritannien von bis zu 3.500 Euro und in Spanien sogar von bis zu 12.000 Euro. Katja Hessel von der FDP hätte sich 5.000 Euro für Deutschland gewünscht. CDU-Politiker Güntzler wollte bei dem Thema nicht in einen Basar wechseln, in dem jeder sich mit einer höheren Summe überbietet, eine Arbeitsgruppe der Union hatte aber immerhin 3.500 Euro vorgeschlagen. Lediglich Wiebke Esdar von der SPD gab sich zurückhaltender und sprach davon, dass man die Auswirkungen auf den Haushalt bei zu großen Steuerfreibeträgen im Blick behalten müsse.
Die geplante Stundungsregelung greift zu kurz
Laut dem aktuellen Entwurf sollen Mitarbeiter ihre Beteiligungen erst nach zehn Jahren versteuern müssen. Das gilt etwa für den Erwerb von Geschäftsanteilen einer GmbH oder von Aktien bei einer Aktiengesellschaft. Zu kurz sei dieser Zeitraum, findet CDU-Politiker Güntzler. Er hätte sich eher 15 Jahre gewünscht. Denn würde immer bereits nach zehn Jahren die Besteuerung anfallen, droht in seinen Augen die Gefahr eines „dry income“. Davon ist immer dann die Rede, wenn ein Mitarbeiter vom Arbeitgeber kein Geld, sondern einen geldwerten Vorteil wie etwa eine Unternehmensbeteiligung erhält und der Arbeitnehmer darauf zu früh steuern entrichten muss – der Angestellte also noch gar nicht über das reale Geld verfügt, um den Steuerbetrag zu leisten. Dieser Effekt kann dazu führen, dass sowohl Gründer als auch deren Arbeitnehmer lieber die Finger von Mitarbeiterbeteiligungen lassen.
Wenn ein Start-up-Mitarbeiter seinen Arbeitgeber verlässt, will die Bundesregierung laut aktuellem Entwurf unmittelbar besteuern. Die zehn-Jahres-Stundung greift in diesem Fall nicht. „Ich habe viel Sympathie dafür, das rauszunehmen”, sagte CDU-Politiker Güntzler in der Podiumsdiskussion, sieht dafür aber kaum Chancen: Denn die Besteuerung läuft aktuell über die Lohnsteuer und die ist bei einem Arbeitgeberwechsel nur noch schwer zu erfassen. Geht es nach einigen Start-up-Vertretern sollten die Steuern grundsätzlich erst dann fällig werden, wenn ein Mitarbeiter einen tatsächlichen Gewinn aus seinen Beteiligungen gezogen hat, also wenn er sie veräußert.
Einige Start-ups drohen, durch das Raster zu fallen
Wie der aktuelle Regierungsentwurf vorsieht, sollen die Erleichterungen nur für Start-ups gelten, die jünger als zehn Jahre sind. Das hatte das Bundesfinanzministerium zuletzt noch einmal auf eine kleine Anfrage der FDP bestätigt. „Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Gründungs- und Wachstumsphase regelmäßig nach zehn Jahren abgeschlossen ist“, heißt es offenbar in dem Schreiben, das unter anderem Gründerszene vorliegt. Nach dieser Zeit seien die Unternehmen selbst in der Lage, im internationalen Wettbewerb um Talente zu bestehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Gesetzentwurf an der europäischen Definition für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) orientiert. Ein Start-up mit mehr als 250 Mitarbeitern oder einer Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro würde so nicht mehr von den Regelungen profitieren.
Die gute Nachricht für die Start-up-Gemeinde: Zumindest die drei in der Podiumsdiskussion anwesenden Mitglieder des Bundestages schienen sich einig, dass beim Gesetzesentwurf noch nachgebessert werden muss. SPD-Politikerin Wiebke Esdar gab sich am Ende optimistisch, noch in dieser Legislaturperiode das Gesetz beschließen zu können. Es werde ein Gesetz, „dass in der Praxis eine Wirkung erreicht, die wir als auch Gesetzgeber intendieren“, sagte sie. Und die Intention sei ganz klar, einen großen Sprung in Sachen Mitarbeiterbeteiligungen zu machen. „Für Mitarbeiterbeteiligungen soll der Standort Deutschland spürbar besser werden.“

Newsletter
Startups, Geschichten und Statistiken aus dem deutschen Startup-Ökosystem direkt in deinen Posteingang. Abonnieren mit 2 Klicks. Noice.
LinkedIn ConnectFYI: English edition available
Hello my friend, have you been stranded on the German edition of Startbase? At least your browser tells us, that you do not speak German - so maybe you would like to switch to the English edition instead?
FYI: Deutsche Edition verfügbar
Hallo mein Freund, du befindest dich auf der Englischen Edition der Startbase und laut deinem Browser sprichst du eigentlich auch Deutsch. Magst du die Sprache wechseln?