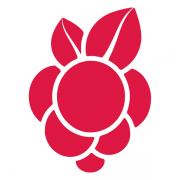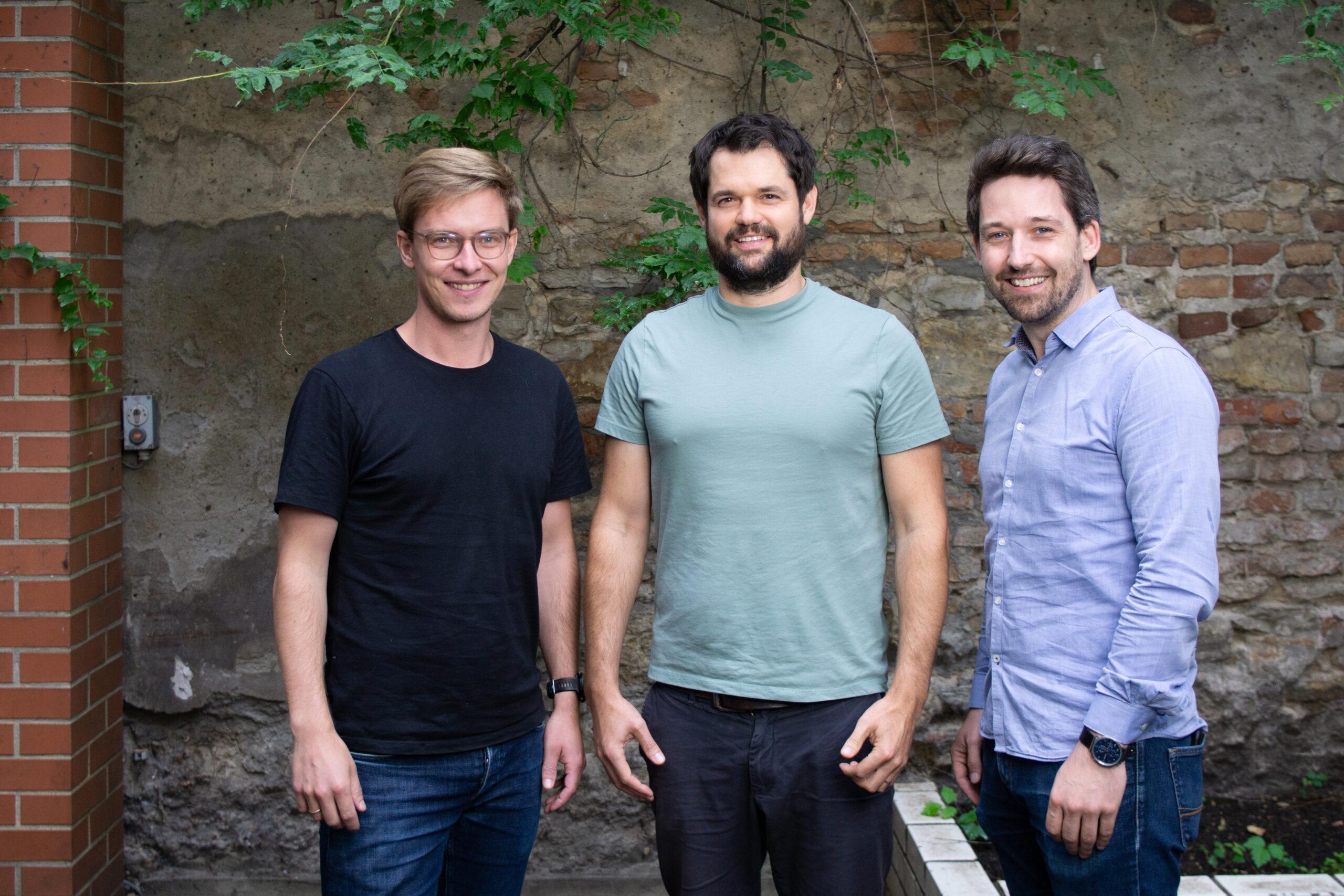Wie Start-ups die HR-Branche erobern

Einerseits herrscht Fachkräftemangel, andererseits senden Unternehmen noch immer langweilige Jobanfragen auf Linkedin und Xing heraus. Viele Gründer sehen hier eine Marktlücke: HR-Start-ups haben Konjunktur.
Ein Personalvermittler schaltet eine Stellenanzeige auf Xing, er sucht einen Senior Java Software Engineer. Die Konkurrenz ist hart, denn derzeit bleibt jede dritte offene Stelle in IT-Berufen unbesetzt, wie eine Studie von Kofa gezeigt hat. Wer einen guten Entwickler überzeugen möchte, muss sich Mühe geben.
Und doch wirkt der Text des Gesuchs sehr generisch. „Sie stehen für Innovation und Modernisierung von Geschäftsprozessen und wollen in einem Unternehmen arbeiten, welcher (sic!) der Schlüssel zum Erfolg ist?“ Das ist der erste Satz. Um welches Unternehmen genau es geht, wird in der Stellenanzeige nicht erwähnt. Von einer „überdurchschnittlichen Vergütung“ ist die Rede – wie hoch genau, wird aber offengelassen.
Langweilige Xing-Anfragen
Ob das genügt, um das Interesse einer heiß begehrten IT-Fachkraft zu wecken? Eher nicht. Doch Stellenanzeigen wie diese gibt es zuhauf, ständig landen langweilig formulierte Mails von Personalvermittlern in den Linkedin- und Xing-Postfächern begehrter Fachkräfte. Es scheint fast so, als hätten die Unternehmen auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern kapituliert. Diese Schwäche haben Gründer erkannt – und gründen HR-Start-ups. Den perfekten Kandidaten für eine Stelle suchen nun nicht mehr Menschen, sondern Algorithmen. Doch Experten warnen vor diesem Trend und mahnen an, sich nicht nur auf die Software zu verlassen.
In den USA gäbe es KI-basierte HR-Beratung schon länger, erklärt Guido Friebel, Professor für Personalwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. „Aber dort wurde die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut ist, sich nur auf die Algorithmen zu verlassen“, sagt er. „Unternehmen verlieren ansonsten ihre Kompetenzen im HR-Bereich und somit die Kontrolle darüber, wen sie einstellen und wen nicht.“
Derzeit kapitulieren die Personalabteilungen vor der Fülle an Daten, die es aufgrund von Plattformen wie Linkedin oder Stepstone mittlerweile gibt.
Guido Friebel, Professor für Personalwirtschaft an der Goethe-Universität
Stattdessen sollten die Firmen mehr Data Scientists für ihre Personalabteilung einstellen und selbst Daten zu aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern auswerten. „Derzeit kapitulieren die Personalabteilungen vor der Fülle an Daten, die es aufgrund von Plattformen wie Linkedin oder Stepstone mittlerweile gibt.“
Deutsche Start-ups wie Talentwunder haben das Problem dieses Datendschungels erkannt – und aus der Lösung ein Geschäftsmodell gemacht. Das 2014 gegründete Unternehmen hat eine Software entwickelt, die öffentlich zugängliche Daten aus über 30 Portalen ausliest – darunter sind Jobplattformen wie Linkedin und Xing, aber auch Netzwerke wie Researchgate und Github, auf denen sich eher Fachleute austauschen. Anschließend werden aus den verschiedenen Daten Bewerberprofile zusammengestellt. Sucht nun ein Unternehmen auf Talentwunder nach dem passenden neuen Mitarbeiter, wird ihm direkt eine Rangliste mit möglichen Kandidaten angezeigt.
Talentwunder sucht fähige Kandidaten
„Ob ein Kandidat zum Unternehmen passt, machen wir vor allem von seinen Fähigkeiten abhängig“, erklärt Steffen Tröger, der seit Anfang 2020 Geschäftsführer von Talentwunder ist.
Würde etwa eine Firma aus dem Gastronomiebereich nach dem passenden Sales Manager suchen, würde ihm die Suchmaschine auch Kandidaten vorschlagen, die einen anderen Job haben. „Ein Gastronom hat beispielsweise ebenfalls Verkaufstalente, kennt die Branche, ist sprachgewandt und multitaskingfähig.“
„Die passenden Kandidaten werden oft sehr generisch angeschrieben, weil das Ziel ist, so viele Bewerber wie möglich zu erreichen.“
Steffen Tröger, Geschäftsführer von Talentwunder
Die meisten Unternehmen würden bei der Mitarbeitersuche auf Linkedin nicht derart um die Ecke denken. Ein weiterer Fehler, den Tröger oft beobachtet: „Die passenden Kandidaten werden oft sehr generisch angeschrieben, weil das Ziel ist, so viele Bewerber wie möglich zu erreichen.“
Es sei aber zielführender, wenige – aber dafür passende – Fachkräfte so individuell wie möglich zu kontaktieren. Auch dabei würde Talentwunder seinen Kunden, zu denen unter anderem die Deutsche Bahn, Liebherr und Allianz zählen, helfen. Seit 2020 arbeitet Talentwunder profitabel und Tröger betont mittlerweile, dass sich das Unternehmen selbst nicht mehr als klassisches Start-up sehe.
Rekrutierung günstiger machen
Auch ein anderes HR-Start-up hat erkannt, dass Unternehmen mit der Mitarbeitersuche auf Netzwerken wie Linkedin und Xing überfordert sind: Moberries will Rekrutierung für Unternehmen günstiger machen und automatisieren. „Wir wollen so vielen Menschen bei der Karrieresuche helfen wie möglich und dabei die beste Erfahrung bieten”, verspricht Mitgründer Terence Hielscher.
Dafür hat Moberries ein neuronales Netzwerk entwickelt, also eine Art künstliche Intelligenz. Ihr Ziel: Unternehmen mit den passenden Bewerbern zusammenbringen. Doch anders als Talentwunder sammelt Moberries die Daten nicht auf anderen Jobportalen. Wer für eine Stelle in Frage kommen möchte, muss sich vorab anmelden, das geht auch per Whatsapp oder Telegram.
Netzwerk lernt anhand von Feedback
Danach können Nutzer ihren Lebenslauf einreichen und Fragen beantworten – „je mehr desto besser“, wie Hielscher betont. Die angemeldeten Unternehmen bekommen Kandidaten vorgeschlagen, die der Algorithmus als passend erkennt. Lehnen sie ihn ab, müssen sie ein kurzes Feedbackfeld anklicken und begründen, warum. So lernt das Netzwerk dazu – und auch der Arbeitnehmer.
„30 Prozent der Kandidaten, die der Algorithmus vorschlägt, kommen in die nächste Stufe – führen also ein Bewerbungsgespräch“, sagt Hielscher. Auch bei der Linkedin-Suche nach Mitarbeitern hilft Moberries – Unternehmen können sogenannte virtuelle Recruiter mieten, die Moberries weitergebildet hat.
Auch Algorithmen können diskriminierend sein.
Terence Hielscher, Mitgründer von Moberries
2.000 Unternehmen seien derzeit Kunde bei Moberries, darunter Ionos, Bertelsmann oder auch Volksbanken. Das Konzept scheint aufzugehen. Und doch mahnt sogar der Gründer selbst: „Auch Algorithmen können diskriminierend sein. Sie sind nur so gut, wie der Input, den sie erhalten.“ Erst, wenn sie viele Daten erhalten, seien sie weniger diskriminierend als Menschen.
Eine Einschätzung, die er mit Experten wie Michael Kramarsch teilt. Er ist Gründer der Unternehmensberatung Hkp und hat sich als Investor auf HR-Start-ups, darunter auch Talentwunder, fokussiert. „Würde eine KI mit den Daten der letzten dreißig Jahre den Selektionsprozess für einen Vorstandsposten übernehmen, können Sie sich sicher sein, dass sie einen älteren, weißen Mann wählt“, sagt er.

Daher müsse sichergestellt werden, dass die KI auf Daten hoher Qualität beruht. Zudem müssten auch die Personalabteilungen solche Tools verstehen können, wenn sie sich darauf verlassen. „Ansonsten droht eben auch ein gewisser Autonomieverlust“, warnt er. Personalverantwortliche würden sich dann zu sehr auf Ergebnisse oder Empfehlungen der Technologie ausruhen.
Doch richtig eingesetzt, beschleunige digitale Technologie den Recruiting-Prozess. „Menschen mit den entsprechenden Skills werden schneller gefunden, der Selektionsprozess ist potenziell diskriminierungsfreier.“
Diskriminierung von jungen Müttern
Doch Diskriminierung kann nicht nur während des Bewerbungsprozesses zum Problem werden, sondern auch danach – vor allem für Arbeitnehmer mit familiären Verpflichtungen. Diese Erfahrung musste Sandra Westermann in ihrem alten Job als Produktionsleiterin im TV machen. Mitten in der Elternzeit sei ihr gekündigt worden – obwohl das nicht einmal gesetzeskonform sei.
Danach habe sie einen Job gesucht, der sich mit ihrer neuen Familiensituation vereinbaren ließ– etwa wegen eines flexiblen Arbeitszeitmodells und der Möglichkeit, teilweise von zuhause aus zu arbeiten. „Es gab zwar damals für alles eine Jobbörse, aber nicht für familienfreundliche Jobs“, sagt sie. Daher habe sie sich Ende 2018 dazu entschieden, ein eigenes Jobportal aufzubauen. Die Zielgruppe? Vor allem Mütter, aber auch junge Frauen ohne Kinder. Zehn Prozent der Nutzer seien männlich, so die Gründerin.

„Superheldin“, so der Name des Start-ups, verdient pro inserierter Stellenanzeige. „Außerdem beraten wir die Unternehmen beim Recruiting von Frauen“, sagt Westermann. Sie und ihr Team würden jedes Inserat prüfen und entscheiden, ob es den Ansprüchen genüge. Dazu würden nicht nur die Arbeitsbedingungen gehören, sondern auch Formulierungen.
Frauen lassen sich schneller abschrecken
„Frauen lassen sich von hohen Anforderungen schneller abschrecken als Männer“, so die Gründerin. Ein Beispiel sei „verhandlungssicheres Englisch“ – häufig würden Unternehmen damit nur meinen, dass sie Angestellte mit soliden Englischkenntnissen suchen. „Wir melden den Unternehmen dann zurück, was sie besser machen können.“
Das würden viele der Kunden – zu denen auch die Deutsche Bundesbank gehört – dankend annehmen. Schließlich würden Unternehmen wegen des Fachkräftemangels, aber auch wegen der Frauenquote, händeringend nach Mitarbeiterinnen suchen. Generische Stellenanzeigen auf Xing und Linkedin reichen da längst nicht mehr aus.
FYI: English edition available
Hello my friend, have you been stranded on the German edition of Startbase? At least your browser tells us, that you do not speak German - so maybe you would like to switch to the English edition instead?
FYI: Deutsche Edition verfügbar
Hallo mein Freund, du befindest dich auf der Englischen Edition der Startbase und laut deinem Browser sprichst du eigentlich auch Deutsch. Magst du die Sprache wechseln?